
Aktuelles
Pilotprojekt Sea Ranger
Aus der Fischereigenossenschaft Wismarbucht eG kommt eine zukunftsfähige Idee den Fischereiberuf in der westlichen Ostsee an aktuelle Gegebenheiten anzupassen (Überfischung, Klimawandel, Biodiversitätsverlust/-Wandel). Dafür wurde das Konzept Sea Ranger erdacht, das SpaCeParti begleitet und mitgestaltet. Dabei geht es um die Diversifizierung des Fischereiberufs, um Aufgaben in Naturschutz, Öffentlichkeitsarbeit und Ökosystemmanagement in Zusammenarbeit mit Behörden und Forschung. An der Zusatzausbildung in der Berufsschule Sassnitz nehmen zurzeit 11 Fischer teil. Forschende aus SpaCeParti haben bereits im Oktober Schultage gestaltet und werden im Februar 2024 weitere Vorlesungen durchführen.
Initiative Reallabor-Gesetz
Die Reallabore in SpaCeParti werden von Forschend des Center for Ocean and Society (CeOS) der Christian-albrechts -Universität zu Kiel geleitet. Das CeOS ist Mitglied im „Netzwerk Reallabore der Nachhaltigkeit“ und hat in den letzten Jahren die Entwicklung mariner Reallabore wesentlich geprägt.
Deshalb unterstützt das CeOS ein Positionspapier des Netzwerks „Reallabore der Nachhaltigkeit“, wie Reallabore zukünftig in der Gesetzgebung gefördert werden könnten. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima organisiert derzeit eine online-Konsultation zu einer Initiative für ein Reallabor-Gesetz.
Das Netzwerk betont in seiner Stellungnahme mehrere Aspekte: die Bedeutung einer konsequenten Nachhaltigkeitsorientierung und weitreichender Partizipation, ergebnisoffenen Experimentierens sowie des transformativen Lernens.
Konferenz „Reallabore – ExperimentierRäume für den Weg in eine nachhaltige Gesellschaft“
Am 11. und 12. April 2024, im Deutsches Hygiene-Museum Dresden, veranstaltet durch Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR).
Forschende aus SpaCeParti werden eine Session zu Reallaboren in marinen Räumen leiten. Weitere Informationen sind auf der Tagungswebseite zu finden.
Lehrpfad Küstenkultur
Im Reallabor Stein-Wendtorf entwickeln wir zusammen mit Stakeholdern aus lokaler Fischerei, Tourismus, Gemeindevertretungen, NABU und Gastronomie einen Lehrpfad zum Thema Küstenkultur. Geplant ist diesen wird im Frühjahr 2024 fertigzustellen und im Frühsommer öffentlich präsentieren zu können.
Themenschwerpunkt ist die Zukunft der Küstenfischerei. Dazu organisieren SpaCeParti Mitarbeitende mehrere Veranstaltungsformate. Vor Ort wird eine eigene Session geleitet, Vorträge wie auch Poster präsentiert:
“Small-scale fisheries under global change – threats and opportunities” – Sessionleitung Heike Schwermer (Session K, zusammen mit Steffen Funk (Universität Hamburg) und Camilla Sgoutti (Universität Padova))
“The role of climate change and socio-economic factors for multiple tipping points in the small-scale herring fishery in the Western Baltic, 1200-1600” – Rüdiger Voss (Vortrag Session K)
“The potential for, and challenges of, transdisciplinary research & real-world laboratories for building towards ocean sustainability” – Kai de Graaf (Vortrag Session M)
“How much is the Fish? Adopting an ego-network lens to reconstruct historic seafood trade networks in small-scale fisheries” – Rüdiger Voss (Poster Session K)
“Hooked on sustainability: optimising quota allocation for Western Baltic cod small-scale fisheries” – Robin Fleet (Poster Session K)

Für mehr Programmdetails: https://www.ices.dk/events/asc/2023/Pages/Programme.aspx
Josefine Gottschalk, Wissenschaftlerin in unserer Forschungsmission und im Projekt SpaCeParti, spricht am 08. September bei der Auftakt-Veranstaltung zur »Woche des bürgerschaftlichen Engagements« 2023 über ihr Engagement für Meere. Es waren die Meeresschildkröten, soviel sei hier schon verraten, die zu der Einladung geführt haben. Herzlichen Glückwunsch, Josefine!
Hier geht es zur Auszeichnung der Veranstaltung!

![]()
In Heiligenhafen fand 06. September ein weiterer Fischereidialog mit reger Teilnahme statt. Es wurden spannende Vorträge zu Themen „Ostseefischerei im Klimawandel“ (Fietz, Reßing, Albrecht), „Küstennahe Sauerstoffminimumzonen in der Ostsee“ (Hepach, Schlundt) und „Neues zum Kormoran“ (Knoop) gehalten.
Zudem wurden von Oilver Greve und Kai de Graaf aus dem SpaCeParti Reallabor Wismarbucht Neuigkeiten zur Pilotausbildung Sea Ranger präsentiert.
Vielen Dank für einen wunderbaren Austausch und das konstruktive Miteinander.

Seit Dezember 2021 untersuchen mehr als 250 Wissenschaffende in der durch das BMBF mit 25 Millionen € geförderten DAM-Forschungsmission Schutz und nachhaltige Nutzung mariner Räume in zwei Pilotvorhaben und fünf Forschungsverbünden die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Nutzung und Belastung in den deutschen Meeresgebieten.
Vom 30.08. – 01.09.2023 fand an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel die Missions-Mid-Term-Konferenz statt. Hier wurde neben dem wissenschaftlichen Austausch vor allem Vertreter aus Politik und Industrie, von Verbänden und Gemeinden aus Norddeutschland über die die bisherigen Ergebnisse der Mission informiert.
Darüber hinaus war die Veranstaltung eine Plattform für einen interaktiven Austausch mit Stakeholdern und Wissenschaftlern zum Thema “Schutz und nachhaltige Nutzung mariner Räume”. Dazu wurden Workshops abgehalten, welche die Integration der verschiedenen Bedarfe und Sichtweisen der Teilnehmer ermöglichen. Folgende Themen wurden dazu ausgewählt:
1. Auswirkungen Klimawandel auf marine Ökosysteme & Küstenschutz
2. Multi-Use – Perspektiven im Kontext der Nordsee als Europas Grünes Kraftwerk
3. Auswirkung von Verschmutzung & Munition auf marine Ökosysteme
4. Erhalt der marinen Biodiversität und Bedeutung von Schutzgebieten
5. Zukunft der Fischerei
6. Methoden für Monitoring und Bewertung
Wir freuen uns, dass die MTC sowohl als „European Maritim Day 2023 in my country“ – als auch als UN Ozean Dekaden Aktivität anerkannt worden ist.
Wir bedanken uns für eine gelungene und informative Konferenz bei allen Beteiligten und Teilnehmenden.
Vom 30. August bis 1. September 2023 fand an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel die Mid Term Konferenz der Forschungsmission „Schutz und nachhaltige Nutzung von Meeresgebieten ─ sustainMare“ der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) statt.
Über die Forschungsmission sustainMare
In der Forschungsmission „Schutz und nachhaltige Nutzung mariner Räume“ – kurz: sustainMare – der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) untersuchen rund 250 Forschende in zwei Pilot- und fünf Verbundprojekten, wie zukünftig eine nachhaltige Nutzung bei gleichzeitigem Schutz der Meere gewährleistet werden kann. Durch inter- und transdisziplinäre Forschungsansätze sollen das Wissen über multiple Stressoren und die Auswirkungen des Klimawandels auf das Ökosystem Meer erhöht und mithilfe von Zukunftsszenarien konkrete Handlungsempfehlungen für und mit verschiedenen Zielgruppen erarbeitet werden. Übergreifend koordiniert wird sustainMare am Helmholtz-Zentrum Hereon. Seit Dezember 2021 wird sustainMare in seiner ersten dreijährigen Phase vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 25 Mio. Euro gefördert. Die DAM erarbeitet mit ihren 22 Mitgliedseinrichtungen lösungsorientiertes Wissen und Handlungsoptionen für einen nachhaltigen Umgang mit den Küsten, Meeren und dem Ozean.
Über die Forschungsmission sustainMare: https://www.sustainmare.de/
Über die Deutschen Allianz Meeresforschung: https://www.allianz-meeresforschung.de/
Über den „European Maritime Day in my Country“: https://maritime-day.ec.europa.eu/my-country_en
Für die Öffentlichkeit wurde am 30.08. ein Vortrag an der CAU gehalten, der mit einem fast vollen Hörsaal sehr gut besucht war:

Dr. Felix Mittermayer und Dr. Steffen Funk gaben auf dem 9. Dialog kleine Küstenfischerei, veranstaltet im Rahmen des Projektes balt_ADAPT im Fischeramt in Neustadt in Holstein, Einblicke in aktuelle Fischereiwissenschaftliche Forschungen des GEOMARs und der Universität Hamburg rund um den Hering und den Dorsch in der Ostsee.
Dr. Mittermayer zeigte dabei wie in den vergangenen Jahren das GEOMAR bei der Entwicklung zur genetischen Bestandstrennung der beiden Ostsee-Dorsch-Bestände (d.h. westlicher und östlicher Ostseedorsch) beitrug. Des Weiteren gab er spannende Einblicke in die Veränderung der Ernährung des östlichen Ostseedorsches, welche maßgeblich auch mit der Änderung der Umweltfaktoren einher geht, und welche mit Hilfe von Isotopenanalysen aufgedeckt wurde. Darüber hinaus gab es aktuelle Einblicke in laufende Forschungsarbeiten zum westlichen Frühjahrslaicher-Hering, wobei Analysen eines Fangtagebuches des Nord-Ostsee-Kanal-Fischers eindrucksvoll aufzeigten, dass die Heringe mittlerweile früher auf ihren Laichzeiten erscheinen als in der Vergangenheit, was mit milden Wintern im Rahmen des Klimawandels in Verbindung gebracht wird.
Dr. Funk gab Einblicke in Forschungen rund um die Ökologie des westlichen Ostseedorsches. Hierbei wurde vor allem die Bedeutung des ökologischen Wissens der Fischer veranschaulicht, was in aktuellen Studien dazu beitrug räumlich-zeitliche Verbreitungsmuster der Dorsche zu entschlüsseln und darüber hinaus Schwachpunkte von wissenschaftlichen Monitoringsurveys (durch eine limitierte räumliche Abdeckung) aufzeigte. Auch wurden neueste Studien zur Dorsch-Ernährung und zum Wachstum gezeigt. In den Modellierungen konnten lang andauernde Hochsommerphasen als kritische Phasen für den westlichen Ostseedorsch identifiziert werden, welche insgesamt zu einem verringerten Wachstum, einer schlechteren Kondition und letztlich auch zu einem verringerten Reproduktionspotential führen können.

Im April 2023 trafen sich Teilnehmende der Arbeitsgruppe Stakeholder-Interaktion der Forschungsmission sustainMARE der Deutschen Allianz Meeresforschung, um sich über Methoden, Formate und Forschungsprojekte auszutauschen.
Es wurde sich interdisziplinär über Forschungsinhalte, Projekte und Aktivitäten mit Stakeholdern ausgetauscht. Da in dieser Gruppe Menschen aus verscheidenen akademischen Disziplinen und Erfahrungen aus unterschiedlichen Stakeholder-Interaktion sind, ist der Austausch miteinander extrem bereichernd und trägt zur strukturierten transdisziplinären Zusammenarbeit bei.

Fischerfamilie Meyer und CeOS Mitarbeiterin Heike Schwermer berichten über die Situation der Ostsee und der Küstenfischerei.
Teilnehmende des SpaCeParti Reallabors Stein-Wendtorf wurden für das NDR DAS! Magazin interviewt und berichten über die Kooperation von Fischerei und Forschung.
Link zum Programm HIER
Vorträge mittwochs 19:00 – 20:00 Uhr, digital via Zoom
Am 21.02.2023 trafen sich Anna Kassautzki (MdB, SPD) und Delara Burchardt (MEP, SPD), mit den CeOS-Mitarbeitende Heike Schwermer, Marie-Catherine Riekhof, Christian Wagner-Ahlfs, Kai de Graaf, Rüdiger, um zu aktuellen Fragen einer nachhaltigen und zukünftigen Ostseefischerei zu diskutieren.
Die Projekte balt_ADAPT und SpaCeParti wurden mit explizitem Bezug auf die transdisziplinäre Arbeitsweise mit der kleinen Küstenfischerei, Natur- und Umweltschutz und Tourismus vorgestellt.
Beide Projektefokussieren Ferner wurde ein Blick in die Zukunft gewagt und die bio-ökonomischen Modellierungen der Fischbestände Westlicher Dorsch (Gadus morhua) und Hering (Clupea harengus)vorgestellt und diskutiert.
Beiderseits konnten wichtige und spannenden Informationen ausgetauscht werden, in einer positiven und konstruktiven Atmosphäre.
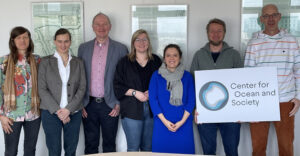 Heike Schwermer, Marie-Catherine Riekhof, Christian Wagner-Ahlfs, Anna Kassautzki, Delara Burchardt, Kai de Graaf, Rüdiger Voss[/caption]
Heike Schwermer, Marie-Catherine Riekhof, Christian Wagner-Ahlfs, Anna Kassautzki, Delara Burchardt, Kai de Graaf, Rüdiger Voss[/caption]
Im Reallabor Stein-Wendtorf fand ein erster umfassender Stakeholder-Workshop statt, bei dem sich auf ein gemeinsames Pilotprojekt geeinigt wurde.
2022 haben wir Interviews und Recherchen mit Stakeholdern vor Ort durchgeführt und zusätzlich mit einer Fokusgruppe erste Projektideen für das Reallabor entworfen. Ziel der Fokusgruppe war es eine Projektidee zu entwickeln, welche etwas für die lokale Fischerei beiträgt und Stakeholder vor Ort miteinander vernetzt. Diese Ideen konnten wir am 08.02.23 einer größeren Gruppe von Stakeholdern vorstellen. Die Projektidee eines Info-Pfades zum Thema Küstenkultur traf durchweg auf positive Zustimmung, so dass wir nun mit dem ersten Projekt im Reallabor beginnen werden und dafür eine bunte gemischte Stakeholder-Gemeinschaft begeistern konnten. Weitere Konzeptions- und Umsetzungstreffen folgen in den kommenden Monaten.
Transdisziplinäre Forschung ist ein wachsendes Feld in der Wissenschaft, dennoch gibt es bis heute keine einheitliche Definition. Dem wirkt das interdisziplinäre Team des Center for Ocean and Society mit der neuen Publikation “The multifacted picture of transdisciplinarity in marine reseach” entgegen.
Die transdisziplinäre Forschung wird oftmals mit disziplinärer, multi- und interdisziplinärer Forschung verglichen. Während die disziplinäre Forschung nur eine Disziplin umfasst, schließen multi- und interdisziplinäre Forschung mehrere Disziplinen ein. Der Unterschied zur interdisziplinären Forschung besteht dabei in der Zusammenarbeit aller Disziplinen, um die im Rahmen eines bestimmten Projekts festgelegten Ziele zu erreichen. Die transdisziplinäre Forschung bezieht zusätzlich Interessengruppen mit unterschiedlichem Hintergrund ein.
Grünhagen, C., Schwermer, H., Wagner-Ahlfs, C., Voss, R., Gross, F., & Riekhof, M.-C. (2023). The multifaceted picture of transdisciplinarity in marine research. In S., Gomez Mestres & V., Köpsel, Transdisciplinary Marine Research – Bridging Science and Society (Volume 1). Abingdon: Routledge.

Wichtiger & spannender Austausch mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) auf Vilm. Im Fokus standen Fragen zu ökologischen, sozialen und ökonomischen Inhalten des derzeitigen und zukünftigen Meeresnaturschutz für Nord- und Ostsee.
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der sustainMare Mission trafen am 24.01.2023 VertreterInnen des Bundesamts für Naturschutz auf der Insel Vilm. Ziel des Workshops war es, Fragen im Bereich Meeresnaturschutz aller 7 Projekte zu diskutieren, Wissens- und Datenlücken zu benennen und eine zukünftige, gemeinsame Zusammenarbeit zu thematisieren. Spezieller Fokus lag auf den Themen Fischerei, Governance und Monitoring.

Der sechste BUND-Forschungspreis für nachhaltige Entwicklung zeichnet erstmalig ein marines Thema aus.
Unsere SpaCeParti Kollegin Josefine Gottschalk, MSP-Expertin vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden (IÖR), erhielt den diesjährigen BUND-Forschungspreis für „Forschung zur nachhaltigen Entwicklung“ für ihre Masterarbeit mit dem Titel “Scratching Below Surface – Is the Maritime Spatial Planning of the European Union ready for Adequate Marine Conservation?”. In ihrer Arbeit thematisiert sie die unzureichende Integration ökologischer Aspekte in die Meeresraumplanung. Dazu untersuchte sie die aktuelle Raumordnungsplanung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone beispielhaft auf strukturelle (Biodiversität) und auf funktionale (Ökosystemfunktionen) Komponenten der marinen Umwelt.
Mit ihrer Arbeit wurde erstmalig eine Forschungsleistung zu einem marinen Thema durch den BUND ausgezeichnet. Der Preis erkennt herausragende Leistungen an, die zu einer stärkeren Ausrichtung des Wissenschaftssystems an den großen gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen.
Dies unterstreicht die Bedeutung eines sich durch menschliche Aktivitäten rasant wandelnden Naturraumes und die sich daraus ergebende steigende gesellschaftliche Relevanz einer nachhaltigen Entwicklung auf See.
Außerdem wurde für ihre Arbeit mit dem Carla von Simson-Preis der TU Berlin für diese Arbeit mit dem 1. Platz ausgezeichnet.

Der Dorschbestand der westlichen Ostsee ist zusammengebrochen – gezielte Fischerei auf diesen Bestand ist verboten. Die Suche nach nachhaltige Lösungen, wie etwa dem Reallabor-Ansatz, sind neu entfacht.
Ein Strukturwandel in der Fischerei ist in vollem Gange – Fischereibetriebe verschwinden, Fischereigenossenschaften müssen schließen, ganze Küstenregionen verändern sich.
Denn der Bestand des westlichen Ostseedorsches ist zusammengebrochen, weshalb der gezielte Fang durch die Fischerei aktuell verboten ist.
Während die Diskussionen über mögliche Gründe bereits seit vielen Jahren geführt werden, ist die Suche nach möglichen Lösungen neu entfacht. Das Projekt SpaCeParti, koordiniert durch das Center for Ocean and Society, erprobt in einem sogenannten Reallabor-Ansatz nachhaltige Nutzungsstrategien zur Erhaltung der Küstenfischerei der westlichen Ostsee. Akteur:innen aus den Gruppen Küstenfischerei, Natur- und Umweltschutz, Tourismus und erneuerbare Energien nehmen aktiv an diesem Forschungsprojekt teil.
Weitere Informationen gibt es hier:
Hübbe, Morten. 2022. Küstenfischerei. Der Dorsch verschwindet. Katapult MV.
Mitarbeitende des Projekts SpaCeParti folgen dem Aufruf zur Beteiligung am Sonderband „Zukunft der Fischerei in Deutschland“.
Prof. Dr. Arlinghaus (Herausgeber der Zeitschrift für Fischerei) und Prof. Dr. Möllmann (u.a. beteiligt im Projekt SpaCeParti) haben den Sonderband ins Leben gerufen, um ein Diskussionsforum zu bieten. Dabei geht es vor allem um praxisrelevante Fragen zu Meeres- und Binnenfischerei, Angelfischerei sowie Aquakultur, um Lösungsvorschläge aus verschiedenen Perspektiven der Forschung, Fachpolitik und der gesellschaftlichen Interessensvertretung für die Zukunft darzustellen.
Der Aufruf zur Beteiligung geht ausdrücklich an die Gemeinschaft aller Interessierten aus Fischerei, Forschung, Verwaltung, Politik und Nichtregierungsorganisationen, um einen konstruktiven Diskurs anzuregen.
Im Konsortium SpaCeParti freuen wir uns diesem Aufruf zu folgen, uns aktiv zu beteiligen und unser Wissen einzubringen.

Verknüpfung von verschiedenen Forschungsinhalten innerhalb des Projekts SpaCeParti zum Thema kleine Küstenfischerei und deren Verbindung mit Wissensinhalten von Stakeholdern.
Interdisziplinäre Forschung lebt vom gegenseitigen Austausch miteinander und zwischen den Fachdisziplinen. Deshalb begab sich das Konsortium des Projekts SpaCeParti für fünf Tage in das Klosterhotel Damme. Hier wurden in angenehmer Atmosphäre Ergebnisse präsentiert, Inhalte diskutiert sowie Absprachen und neue Ideen für das weitere Vorgehen entwickelt. Dieser Austausch wurde von allen Seiten als sehr produktiv empfunden und hat einen Grundstein für die weitere Arbeit in den einzelnen Arbeitspaketen gelegt.
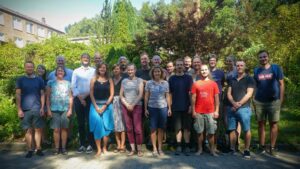
Positive Erfahrungen und Begegnungen im Austausch mit Fischern und Stakeholdern rund um die kleine Küstenfischerei auf Rügen und Region Greifswalder Bodden.
Um einen Ort für das zweite Reallabor in Mecklenburg-Vorpommern zu finden, wurde von Mitgliedern des Arbeitspaket 1 „Reallabore“ eine mehrtägige Exkursion in den Großraum Rügen und Greifswalder Bodden durchgeführt. Ziel war es in persönlichen Kontakt mit lokalen Fischern und Fischereigenossenschaften zu treten sowie mit Institutionen um die Fischerei herum (bspw. Museen, Kunstschaffende und Tourismusakteure). Hierbei konnten wir uns einen weitreichenden Überblick zur aktuellen Situation der Fischerei verschaffen und zudem Informationen und Daten sammeln. Wir freuen uns viele Menschen der Branche getroffen zu haben, die bereit waren sich mit uns über Hering und Dorsch sowie die aktuellen Herausforderungen für die Fischerei auszutauschen.
Projektinterne Inhalte und Ziele wurden im Dialog miteinander konkretisiert.
Im Juni 2022 konnten wir uns erstmalig mit dem Konsortium des Projektes für zwei Tage in Person in der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel treffen. Dies begünstigte den regen und produktiven Austausch miteinander. Es wurde sich gegenseitig über den Status der Arbeitspakete informiert, Zielvorstellungen konkretisiert und eine interdisziplinäre Infrastruktur aufgebaut. Es wurde klar, dass in diesem Projekt viel Wissen aus verschiedensten Forschungsgebieten vorhanden ist sowie eine starke Motivation mit diesem die kleine Küstenfischerei zu unterstützen.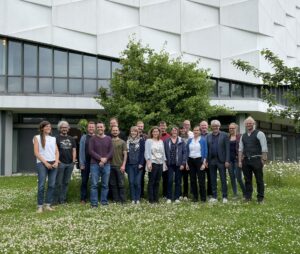
Aufbau des Reallabors (Form von Zukunftswerkstatt) in Stein-Wendtorf, um gemeinsam mit Stakeholdern der Fischerei Problemlösungen zu finden und auszuprobieren.
Kernstück des Projekts werden zwei Reallabore sein. Reallabore sind lokal begrenzte Orte, in denen Forschende und Stakeholder gemeinsam Lösungen für Problemstellungen erarbeiten, um diese vor Ort in Experimenten zu erproben und bei Erfolg aus dem Reallabor heraus an weiteren Orten umsetzen zu können. Bei dieser partizipativen Arbeitsweise findet ein Austausch auf Augenhöhe sowie ein Wissenstransfer zwischen Stakeholdern und Forschenden statt.
Teilnehmende des Arbeitspakets 1 „Reallabore“ trafen sich erstmals am 23.05.2022 mit Stakeholdern des Museumshafens in Stein-Wendtorf, um erste Ideen zu besprechen und eine künftige Zusammenarbeit zu planen. Im Rahmen dieses Austausches ging es auch um die aktuelle Situation der Fischer vor Ort.
Interdisziplinäres Wissenschaftsteam startet Zusammenarbeit, um die kleine Küstenfischerei der westlichen Ostsee auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen.
Ende Februar 2022 fand das Kick-off Meeting zum Projekt SpaCeParti statt. Erstmalig trafen sich das Konsortium des Projekts mit dem wissenschaftlichen Beirat, Vertretenden der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) und des Projektträgers Jülich (PtJ), um sich gegenseitig vorzustellen und erste Absprachen zu treffen.
Es wurden Informationen ausgetauscht und die Möglichkeiten und Ziele des Projekts, nämlich die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft der kleinen Küstenfischerei in der westlichen Ostsee, besprochen. Darüber hinaus fand ein erster Austausch in den Arbeitspaketen statt.
Auf Grund der Corona-Situation fand dieses erste Treffen virtuell statt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


